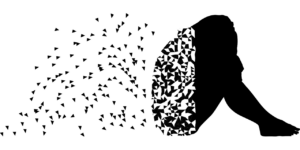
Bild von Gordon Johnson auf Pixabay
Jede vierte Frau und jeder achte Mann hatte in seinem Leben eine oder mehrere Phasen depressiver Störungen und begab sich deswegen in ärztliche oder psychotherapeutische Behandlung. Jetzt arbeiten Forscherinnen und Forscher an einer neuen Therapie.
Es gibt mehrere Formen von Psychotherapie:
- analytische Psychotherapie – klassische durch Sigmund Freud entwickelte Psychoanalyse mit Schwerpunkt von Konflikten aus der Kindheit
- tiefenpsychologisch fundierte Psychotherapie – ähnlich wie die analytische Psychotherapie, aber sie zielt stärker auf die aktuellen Probleme der Patienten ab
- Verhaltenstherapie – Überprüfung des erlernten Verhaltens- und Denkmusters als Ursache der psychischen Probleme
- systemische Therapie – überprüft den Einfluss der Umgebung der Menschen miteinander und bezieht darum wichtige Personen aus dem Umfeld der Patienten ein.
Bisher standen diese Therapieformen nebeneinander und wurden zum Teil als konkurrierende Behandlungsformen kritisiert. Die neue Denkausrichtung beschreitet jetzt den Weg der ergänzenden und sich gegenseitig unterstützenden Konzepte, insbesondere die tiefenpsychologisch fundierte Psychotherapie sieht die Verhaltenstherapie als ergänzende Behandlungsformen an. In Greifswald arbeitet ein Expertenteam in einem Experimentallabor für Seelenheilkunde, das sogenannte Psychotherapy Lab, deren Leiterin Prof. Dr. Eva-Lotta Brakemeier, Lehrstuhlinhaberin für Klinische Psychologie und Psychotherapie an der Universität Greifswald, ist. Die moderne Methode, die tiefenpsychologische und verhaltenstherapeutische Herangehensweisen miteinander verbindet, nennt sich CBASO (cognitive behavioral analysis system of psychotherapie). Diese Methode ist häufig erfolgreich, weil Depressionen fast immer aus interpersonellen Problemen entstehen.
Neben der Psychotherapie spielt auch die medikamentöse Behandlung mit Antidepressiva eine große Rolle. Wie gut Antidepressiva wirken, ist häufig abhängig vom subjektiven Zugang der Patienten, manchmal kann der Placeboeffekt nicht wirklich ausgeschlossen werden. Die Experten meinen aber, dass auch dann eine Therapie sinnvoll ist, wenn die Leidenszeit verkürzt wird und Rückfälle verhindert werden. Citalopram ist eines der am häufigsten verordneten Mittel gegen Depressionen. Es ist ein sogenannter selektiver Serotoninwiederaufnahmehemmer. Die Konzentration des Neurotransmitters ist durch diese Therapie erhöht. Dem Therapiekonzept liegt die Annahme zugrunde, dass bei der depressiven Erkrankung ein Mangel an Botenstoffen zwischen den Hirnzellverbindungen vorliegt. Neue Erkenntnisse sagen aber, dass diese sogenannte Serotoninhypothese falsch ist. Das Narkosemittel Ketamin, auch als Partydroge bekannt, wurde erfolgreich bei Betroffenen eingesetzt, die auf andere Antidepressiva nicht ansprachen. Warum dieses Mittel diese Wirkung hat, wird jetzt erforscht. Der Stoff soll die Übertragung von Informationen zwischen den Hirnzellen verbessern und sogar neue Verbindungsstellen entstehen lassen. Dieser Vorgang wird Plastizität genannt und ist entscheidend für die Fähigkeit zu lernen. Aus früheren Beobachtungen ist bekannt, dass zum Beispiel Stress mit akuter oder chronischer Überlastung die Plastizität senkt. Auch Traumata können Kommunikation zwischen den Hirnzellen behindern. Wenn Menschen nicht mehr gut lernen können, entstehen sogenannte Grübelschleifen, die Betroffenen ziehen sich zurück und versinken in ihren Gedanken, ohne sich mit ihrer Umgebung auszutauschen. Damit ergibt sich auch eine Grundlage für die Hypothese, dass tiefenpsychologische Behandlungsansätze und Verhaltenstherapie sich ergänzen.
mt
Quelle: ZEIT Wissen
Abonnieren Sie unseren Newsletter auf www.medwn.de
